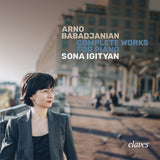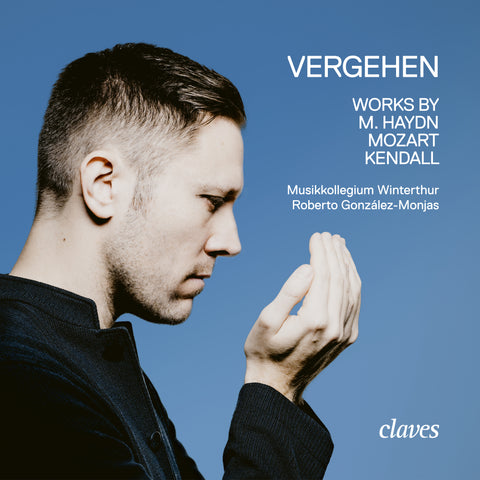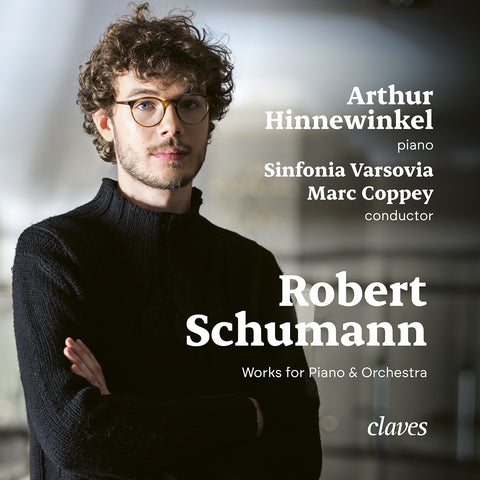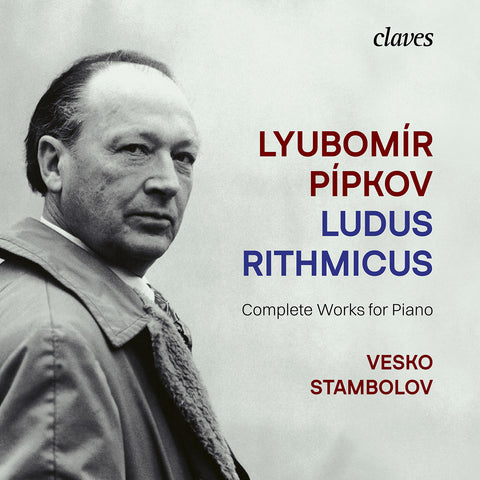(2025) Arno Babadjanian: Works for piano
Kategorie(n): Piano Raritäten
Instrument(e): Piano
Hauptkomponist: Arno Babadjanian
CD-Set: 1
Katalog Nr.:
CD 3131
Freigabe: 26.09.2025
EAN/UPC: 7619931313122
(Wird einige Tage vor dem Veröffentlichungsdatum verschickt).
Dieses Album ist jetzt neu aufgelegt worden. Bestellen Sie es jetzt zum Sonderpreis vor.
CHF 18.50
Dieses Album ist nicht mehr auf CD erhältlich.
Dieses Album ist noch nicht veröffentlicht worden. Bestellen Sie es jetzt vor.
CHF 18.50
Dieses Album ist nicht mehr auf CD erhältlich.
CHF 18.50
Inklusive MwSt. für die Schweiz und die EU
Kostenloser Versand
Dieses Album ist nicht mehr auf CD erhältlich.
Inklusive MwSt. für die Schweiz und die EU
Kostenloser Versand
Dieses Album ist jetzt neu aufgelegt worden. Bestellen Sie es jetzt zum Sonderpreis vor.
CHF 18.50
Dieses Album ist nicht mehr auf CD erhältlich.
This album has not been released yet.
Pre-order it at a special price now.
CHF 18.50
Dieses Album ist nicht mehr auf CD erhältlich.
CHF 18.50
Dieses Album ist nicht mehr auf CD erhältlich.
SPOTIFY
(Verbinden Sie sich mit Ihrem Konto und aktualisieren die Seite, um das komplette Album zu hören)
ARNO BABADJANIAN: WORKS FOR PIANO
Klavierwerke Arno Babadjanian (1921–1983)
„Nur musikalische Ideen, die von Leidenschaft inspiriert sind, können den Zuhörer wirklich bewegen“, schrieb Arno Babadjanian. Der armenische Pianist und Komponist verfolgte einen faszinierenden musikalischen Weg an der Schnittstelle verschiedener Einflüsse. Sein Werk verbindet Folklore und Popmusik mit allen wichtigen musikalischen Strömungen des 20. Jahrhunderts, von Bartóks rhythmischer Kompositionsweise bis zu Schönbergs Zwölftonmusik, wobei auch Jazz und sogar Rock’n’Roll ihre Spuren hinterlassen haben.
Arno Babadjanian wurde 1921 in Eriwan geboren und starb 1983 in derselben Stadt an Leukämie. Schon früh zeigte er musikalische Begabung. Nach seinem Eintritt in das Konservatorium im Alter von sieben Jahren schrieb er nur zwei Jahre später sein erstes Werk, The Pioneers’ Waltz. Ausgestattet mit einem ausgezeichneten Gedächtnis und hervorragenden Fähigkeiten im Vom-Blatt-Spielen, studierte er bei dem armenischen Komponisten Sergei Barkhudaryan (1887–1972). Anschließend setzte Babadjanian seine Ausbildung am Moskauer Konservatorium in der Klasse von Konstantin Igumnov (1873–1948) fort und vertiefte seine Kenntnisse über Bach – dessen Kontrapunkt ihn faszinierte – sowie Beethoven, Chopin und Rachmaninow. Nach seinem Abschluss in Klavier und Komposition im Jahr 1948 kehrte er nach Armenien zurück, um eine Lehrtätigkeit am Konservatorium in Eriwan aufzunehmen. Sein Werkverzeichnis umfasst etwa zwanzig Werke für Soloklavier oder zwei Klaviere, mehrere Kammermusikstücke – darunter sein berühmtes Klaviertrio in fis-Moll, das 1952 vom Geiger David Oistrach, dem Cellisten Sviatoslav Knushevitsky und dem Komponisten selbst am Klavier uraufgeführt wurde – sowie verschiedene Orchesterwerke. Darunter befinden sich die Poem-Rhapsody (1954), das Klavierkonzert (1944), das Violinkonzert (1948), das Cellokonzert (1962) und die Heroische Ballade für Klavier und Orchester (1950). Babadjanian komponierte auch für Theater und Ballett, schrieb Filmmusik wie The Song of First Love (1958) und schuf Lieder, die von armenischer Folklore geprägt sind.
Die Polyphone Sonate, komponiert 1946 und überarbeitet 1956, ist vielleicht das bedeutendste Klavierwerk des Komponisten. Wie die Pianistin Sona Igityan hervorhob, zeichnet sich das Stück „durch seine technische und rhythmische Komplexität sowie seine polyphone Komposition“ aus.1 Es beginnt mit einem schnellen Präludium, das mit marcato bezeichnet ist und leicht und spritzig klingt. Darauf folgt eine Fuge: Ihr eindringliches, mit Trillern verziertes Thema steigt in herzzerreißenden Wellen zu einem Fortissimo (in der Partitur mit ffff bezeichnet) an, bevor es zu einem Pianissimo abklingt2, mit einer stakkatoartigen linken Hand im unteren Register, die einen Herzschlag evoziert, der allmählich zum Stillstand kommt. Das Stück spiegelt Babadjanian's jahrelanges Studium bei Khachaturian und den Einfluss von Genrikh Litinsky, einem Meister des Kontrapunkts, wider. Der dritte Satz, eine rhythmische und marcato gespielte Toccata, bringt den verspielten und erfinderischen Geist barocker Toccata zurück. Er verwebt zwei Themen, die sich als dasselbe Motiv in unterschiedlichen Tempi erweisen und in einer schillernden Klangexplosion gipfeln.
Zwanzig Jahre später, im Jahr 1964, komponierte Babadjanian die „Sechs Bilder für Klavier“, die eine weitere Inspirationsquelle offenbarten und durch die Verschmelzung von volkstümlichen Einflüssen mit serieller und atonaler Musik einen Meilenstein in der armenischen Musik setzten. Seit Ende der 1950er Jahre hatte der Komponist ein großes Interesse an der Zweiten Wiener Schule entwickelt3. In diesen sechs Miniaturen bereicherte er diese Sprache mit seinen eigenen stilistischen Merkmalen – Natur, Emotion und der volkstümliche Charakter, der sein Werk durchzieht.
Der Zyklus beginnt mit einer Improvisation, die in einem völlig anderen Genre an Louis Couperins unmetrische Préludes erinnert. Obwohl alles in der Partitur präzise notiert ist, bewahrt das Stück ein Gefühl von Freiheit. Laut der Musikwissenschaftlerin Svetlana Sarkisyan erinnert die Einleitung an das Hauptthema von Schönbergs Ein Überlebender aus Warschau4. Das folgende Stück, Folk Song, ist voller Fantasie und mit giocoso gekennzeichnet; es basiert auf punktierten Rhythmen, die an traditionelle Volkstänze erinnern und einen lyrischen Zwischenteil umrahmen. Der amerikanische Musikwissenschaftler Nune Melikyan interpretierte die Toccatina als Beschwörung einer „urbanen Landschaft voller endloser Maschinen und geschäftiger Fabriken“. Die aggressiven kleinen Septimen und Tritonusse suggerieren in der Tat die unaufhörliche Bewegung ewig laufender Maschinen5. Es folgt ein Intermezzo, das durch seinen improvisatorischen Charakter an das erste Bild erinnert. Sein dodekaphonisches Thema erinnert ebenfalls an das Volkslied – der Zyklus baut sich somit durch diese Echos und Spiegeleffekte auf. Das Intermezzo steht im Kontrast zum langsamen und meditativen Choral, der auf einem Ostinato aufgebaut ist, das ein Gefühl der Ruhe und Stille erzeugt. Sein Thema intensiviert sich allmählich und gipfelt im Pianissimo, bevor es zu seinem ernsten Charakter zurückkehrt. Schließlich beschließt der Sassoun-Tanz die Reihe mit einem traditionellen armenischen Kochari, einem Reigen, der von Gruppen von Männern getanzt wird. Das Stück besticht durch seinen ständig wechselnden Takt: 5/8, 4/8, 7/8, 5/8, 4/8, 7/8, 3/8, 5/8 und so weiter. Die Stadt Sassoun war einer der wichtigsten Orte des Großreichs Armenien (zwischen 190 v. Chr. und 428 n. Chr.). Sie war auch die letzte Stadt, die sich während des Völkermords von 1915 gegen das Osmanische Reich wehrte und eine sechsmonatige Belagerung überstand. Ihre Militär-Tänze sind zu „Symbolen für Tapferkeit, Heldentum und Patriotismus” geworden6. Wieder einmal trifft Folklore auf serielle Musik. Während eines Besuchs in Armenien im Jahr 1965 besuchte der englische Komponist Benjamin Britten eine Aufführung der Six Pictures des Komponisten und war Berichten zufolge fasziniert von der rhythmischen Konstruktion dieses letzten Stücks.
Die Vier Stücke entstanden in verschiedenen Schaffensphasen Babadjanian, wurden jedoch vom Komponisten oft in dieser Reihenfolge als Zyklus aufgeführt. So wurden sie vom Publikum als Zyklus mit armenischen Volksmotiven wahrgenommen. Das Präludium (1943) in b-Moll entwickelt ein elegisches Thema, das wie ein Ruf emporsteigt. In der parallelen Tonart B-Dur verbindet der weitläufige Vagharshapat-Tanz (1943) einen entschlossenen Puls mit einem brillanten, lyrischen, fast romantischen Thema. Er basiert auf dem Lied Yerangi („Nuancen“) von Pater Komitas (1869–1935), dem berühmten armenischen Priester und Musikwissenschaftler, der die armenische Kultur in Westeuropa bekannt machte. Das ein Jahr später komponierte Impromptu in h-Moll folgt derselben melodischen Linie und erinnert zunächst an Frauentänze, dann an Männertänze. Schließlich komponierte Arno Babadjanian 1952 sein Capriccio in Des-Dur, das die schwungvollen, rhapsodischen Melodien der vorherigen Stücke mit einem pulsierenden Walzerrhythmus und brillanter Virtuosität verbindet.
Die Melodie ist eine lange, nostalgische Kantilene, gepaart mit der Humoresque; beide wurden 1970 komponiert. Der Komponist schrieb diese Stücke für seinen Sohn Ara auf Wunsch seines Lehrers. Es handelt sich um einfache Stücke, die für die Aufnahme in Musikschulprüfungsprogramme gedacht sind. Während das Andante an Rachmaninows Stil erinnert, ist die Humoresque ein skurriles, humorvolles Scherzo mit Jazz-Einflüssen.
Obwohl bereits 1969 komponiert, wurde das Stück mit dem Titel „Reflection“ erst 2006 veröffentlicht. Diese Meditation, voller Atonalität und Dissonanzen, spiegelt einen kontemplativen, aber auch unruhigen Gemütszustand wider.
Das „Poem“ schließlich wurde für den Tschaikowski-Wettbewerb komponiert. Für die Ausgabe von 1966 gab das Kulturministerium ein Pflichtstück für die zweite Runde in Auftrag, das alle technischen Möglichkeiten des Instruments demonstrieren sollte. Babadjanian wurde aus zwölf Einsendungen ausgewählt. Das Stück besteht aus zwei kontrastierenden Teilen: einem Andante cantabile, gefolgt von einem fieberhaften und virtuosen Presto brillante. Bei seiner Uraufführung wurde es vom Publikum begeistert aufgenommen.
Bénédicte Gandois
Übersetzt aus dem Englischen mit www.DeepL.com/Translator
- Der Autor dankt Sona Igityan für ihre Kommentare zu den Arbeiten an dieser Aufnahme.
- Genrikh Litinsky ist beispielsweise Autor von Sowjetische polyphone Kunst (1954) und Polyphone Übungen für Komponisten (1965), und sein Artikel Einige Merkmale der sowjetischen Kompositionsschule begründete 1986 die moderne sowjetische Kontrapunktschule. Quelle: Nune Melikyan, Arno Babadjanian: an Armenian Composer in the Soviet Context, S. 23.
- Quelle: Svetlana Sarskisyan, Dedicated to Arno Babadjanian, Eriwan, Antares, 2008, S. 24, zitiert von Nune Melikyan, op. cit.
- Svetlana Sarskisyan, Artikel von 2011, S. 32, zitiert von Nune Melikyan, op. cit..
- Nune Melikyan, op. cit., S. 57.
- Nune Melikyan, op. cit., S. 58.
SONA IGITYAN
Sona Igityan wurde in eine Künstlerfamilie geboren und begann im Alter von sieben Jahren an einer der besten Musikschulen ihrer Heimatstadt Eriwan mit dem Klavierunterricht. Sie hatte das Glück, bei der außergewöhnlichen Lehrerin Venus Haroutunian zu lernen. Dank ihrer ersten Lehrerin erlangte Sona einen besonders tiefen und weichen Klang sowie eine geschmeidige Klaviertechnik. Drei Jahre später gab sie mit dem Nationalen Kammerorchester Armeniens eine bemerkenswerte Aufführung von Bachs Klavierkonzert in g-Moll.
Im Alter von zwölf Jahren wurde Sona für eine Sendung im nationalen Rundfunk ausgewählt und gewann mit siebzehn Jahren den Preis für die beste Darbietung beim New Names Festival in Eriwan. Sona wurde von renommierten Lehrern wie Willy Sarkissian in Armenien, Elisabeth Athanassova, Michel Kiener, Jean-Jacques Balet und Paul Coker in der Schweiz sowie Paco Moya in Spanien unterrichtet. Sie erhielt 1996 ihr Solisten- und Kammermusikdiplom am Komitas-Staatskonservatorium in Eriwan und 2007 an der Haute École de Musique de Genève. Im Alter von 14 Jahren begann sie ihre Konzertkarriere und ist seitdem als Solistin und Kammermusikerin in verschiedenen Städten in Armenien, Deutschland, Frankreich, den Niederlanden, Spanien und der Schweiz tätig.
In der Schweiz spielt sie regelmäßig bei Musikveranstaltungen wie Musique en été in der Genfer Altstadt, dem Klavierfestival Concertus Saisonnus, dem Festival du Jura, der Fête de la Musique de Genève, den 20heures de Musique in Romont, der Galerie La Primaire in Genf und dem PianoFest Moudon im Waadtland. Das Repertoire von Sona Igityan umfasst verschiedene Epochen und Stilrichtungen, von Barock bis zur zeitgenössischen Musik. Mit einer ausgeprägten Vorliebe für moderne Musik sorgt sie oft für die Aufführung von Werken zeitgenössischer Komponisten wie Ashot Zohrabian, Edouard Sadoyan, Karl Haydmayer und Shauna Beesly. Obwohl Sona sich für verschiedene Formen des künstlerischen Ausdrucks wie Theater, Kino und Literatur interessiert, ist die Musik für sie vor allem eine Art Religion und vermittelt die absolute Wahrheit.
(2025) Arno Babadjanian: Works for piano - CD 3131
Klavierwerke Arno Babadjanian (1921–1983)
„Nur musikalische Ideen, die von Leidenschaft inspiriert sind, können den Zuhörer wirklich bewegen“, schrieb Arno Babadjanian. Der armenische Pianist und Komponist verfolgte einen faszinierenden musikalischen Weg an der Schnittstelle verschiedener Einflüsse. Sein Werk verbindet Folklore und Popmusik mit allen wichtigen musikalischen Strömungen des 20. Jahrhunderts, von Bartóks rhythmischer Kompositionsweise bis zu Schönbergs Zwölftonmusik, wobei auch Jazz und sogar Rock’n’Roll ihre Spuren hinterlassen haben.
Arno Babadjanian wurde 1921 in Eriwan geboren und starb 1983 in derselben Stadt an Leukämie. Schon früh zeigte er musikalische Begabung. Nach seinem Eintritt in das Konservatorium im Alter von sieben Jahren schrieb er nur zwei Jahre später sein erstes Werk, The Pioneers’ Waltz. Ausgestattet mit einem ausgezeichneten Gedächtnis und hervorragenden Fähigkeiten im Vom-Blatt-Spielen, studierte er bei dem armenischen Komponisten Sergei Barkhudaryan (1887–1972). Anschließend setzte Babadjanian seine Ausbildung am Moskauer Konservatorium in der Klasse von Konstantin Igumnov (1873–1948) fort und vertiefte seine Kenntnisse über Bach – dessen Kontrapunkt ihn faszinierte – sowie Beethoven, Chopin und Rachmaninow. Nach seinem Abschluss in Klavier und Komposition im Jahr 1948 kehrte er nach Armenien zurück, um eine Lehrtätigkeit am Konservatorium in Eriwan aufzunehmen. Sein Werkverzeichnis umfasst etwa zwanzig Werke für Soloklavier oder zwei Klaviere, mehrere Kammermusikstücke – darunter sein berühmtes Klaviertrio in fis-Moll, das 1952 vom Geiger David Oistrach, dem Cellisten Sviatoslav Knushevitsky und dem Komponisten selbst am Klavier uraufgeführt wurde – sowie verschiedene Orchesterwerke. Darunter befinden sich die Poem-Rhapsody (1954), das Klavierkonzert (1944), das Violinkonzert (1948), das Cellokonzert (1962) und die Heroische Ballade für Klavier und Orchester (1950). Babadjanian komponierte auch für Theater und Ballett, schrieb Filmmusik wie The Song of First Love (1958) und schuf Lieder, die von armenischer Folklore geprägt sind.
Die Polyphone Sonate, komponiert 1946 und überarbeitet 1956, ist vielleicht das bedeutendste Klavierwerk des Komponisten. Wie die Pianistin Sona Igityan hervorhob, zeichnet sich das Stück „durch seine technische und rhythmische Komplexität sowie seine polyphone Komposition“ aus.1 Es beginnt mit einem schnellen Präludium, das mit marcato bezeichnet ist und leicht und spritzig klingt. Darauf folgt eine Fuge: Ihr eindringliches, mit Trillern verziertes Thema steigt in herzzerreißenden Wellen zu einem Fortissimo (in der Partitur mit ffff bezeichnet) an, bevor es zu einem Pianissimo abklingt2, mit einer stakkatoartigen linken Hand im unteren Register, die einen Herzschlag evoziert, der allmählich zum Stillstand kommt. Das Stück spiegelt Babadjanian's jahrelanges Studium bei Khachaturian und den Einfluss von Genrikh Litinsky, einem Meister des Kontrapunkts, wider. Der dritte Satz, eine rhythmische und marcato gespielte Toccata, bringt den verspielten und erfinderischen Geist barocker Toccata zurück. Er verwebt zwei Themen, die sich als dasselbe Motiv in unterschiedlichen Tempi erweisen und in einer schillernden Klangexplosion gipfeln.
Zwanzig Jahre später, im Jahr 1964, komponierte Babadjanian die „Sechs Bilder für Klavier“, die eine weitere Inspirationsquelle offenbarten und durch die Verschmelzung von volkstümlichen Einflüssen mit serieller und atonaler Musik einen Meilenstein in der armenischen Musik setzten. Seit Ende der 1950er Jahre hatte der Komponist ein großes Interesse an der Zweiten Wiener Schule entwickelt3. In diesen sechs Miniaturen bereicherte er diese Sprache mit seinen eigenen stilistischen Merkmalen – Natur, Emotion und der volkstümliche Charakter, der sein Werk durchzieht.
Der Zyklus beginnt mit einer Improvisation, die in einem völlig anderen Genre an Louis Couperins unmetrische Préludes erinnert. Obwohl alles in der Partitur präzise notiert ist, bewahrt das Stück ein Gefühl von Freiheit. Laut der Musikwissenschaftlerin Svetlana Sarkisyan erinnert die Einleitung an das Hauptthema von Schönbergs Ein Überlebender aus Warschau4. Das folgende Stück, Folk Song, ist voller Fantasie und mit giocoso gekennzeichnet; es basiert auf punktierten Rhythmen, die an traditionelle Volkstänze erinnern und einen lyrischen Zwischenteil umrahmen. Der amerikanische Musikwissenschaftler Nune Melikyan interpretierte die Toccatina als Beschwörung einer „urbanen Landschaft voller endloser Maschinen und geschäftiger Fabriken“. Die aggressiven kleinen Septimen und Tritonusse suggerieren in der Tat die unaufhörliche Bewegung ewig laufender Maschinen5. Es folgt ein Intermezzo, das durch seinen improvisatorischen Charakter an das erste Bild erinnert. Sein dodekaphonisches Thema erinnert ebenfalls an das Volkslied – der Zyklus baut sich somit durch diese Echos und Spiegeleffekte auf. Das Intermezzo steht im Kontrast zum langsamen und meditativen Choral, der auf einem Ostinato aufgebaut ist, das ein Gefühl der Ruhe und Stille erzeugt. Sein Thema intensiviert sich allmählich und gipfelt im Pianissimo, bevor es zu seinem ernsten Charakter zurückkehrt. Schließlich beschließt der Sassoun-Tanz die Reihe mit einem traditionellen armenischen Kochari, einem Reigen, der von Gruppen von Männern getanzt wird. Das Stück besticht durch seinen ständig wechselnden Takt: 5/8, 4/8, 7/8, 5/8, 4/8, 7/8, 3/8, 5/8 und so weiter. Die Stadt Sassoun war einer der wichtigsten Orte des Großreichs Armenien (zwischen 190 v. Chr. und 428 n. Chr.). Sie war auch die letzte Stadt, die sich während des Völkermords von 1915 gegen das Osmanische Reich wehrte und eine sechsmonatige Belagerung überstand. Ihre Militär-Tänze sind zu „Symbolen für Tapferkeit, Heldentum und Patriotismus” geworden6. Wieder einmal trifft Folklore auf serielle Musik. Während eines Besuchs in Armenien im Jahr 1965 besuchte der englische Komponist Benjamin Britten eine Aufführung der Six Pictures des Komponisten und war Berichten zufolge fasziniert von der rhythmischen Konstruktion dieses letzten Stücks.
Die Vier Stücke entstanden in verschiedenen Schaffensphasen Babadjanian, wurden jedoch vom Komponisten oft in dieser Reihenfolge als Zyklus aufgeführt. So wurden sie vom Publikum als Zyklus mit armenischen Volksmotiven wahrgenommen. Das Präludium (1943) in b-Moll entwickelt ein elegisches Thema, das wie ein Ruf emporsteigt. In der parallelen Tonart B-Dur verbindet der weitläufige Vagharshapat-Tanz (1943) einen entschlossenen Puls mit einem brillanten, lyrischen, fast romantischen Thema. Er basiert auf dem Lied Yerangi („Nuancen“) von Pater Komitas (1869–1935), dem berühmten armenischen Priester und Musikwissenschaftler, der die armenische Kultur in Westeuropa bekannt machte. Das ein Jahr später komponierte Impromptu in h-Moll folgt derselben melodischen Linie und erinnert zunächst an Frauentänze, dann an Männertänze. Schließlich komponierte Arno Babadjanian 1952 sein Capriccio in Des-Dur, das die schwungvollen, rhapsodischen Melodien der vorherigen Stücke mit einem pulsierenden Walzerrhythmus und brillanter Virtuosität verbindet.
Die Melodie ist eine lange, nostalgische Kantilene, gepaart mit der Humoresque; beide wurden 1970 komponiert. Der Komponist schrieb diese Stücke für seinen Sohn Ara auf Wunsch seines Lehrers. Es handelt sich um einfache Stücke, die für die Aufnahme in Musikschulprüfungsprogramme gedacht sind. Während das Andante an Rachmaninows Stil erinnert, ist die Humoresque ein skurriles, humorvolles Scherzo mit Jazz-Einflüssen.
Obwohl bereits 1969 komponiert, wurde das Stück mit dem Titel „Reflection“ erst 2006 veröffentlicht. Diese Meditation, voller Atonalität und Dissonanzen, spiegelt einen kontemplativen, aber auch unruhigen Gemütszustand wider.
Das „Poem“ schließlich wurde für den Tschaikowski-Wettbewerb komponiert. Für die Ausgabe von 1966 gab das Kulturministerium ein Pflichtstück für die zweite Runde in Auftrag, das alle technischen Möglichkeiten des Instruments demonstrieren sollte. Babadjanian wurde aus zwölf Einsendungen ausgewählt. Das Stück besteht aus zwei kontrastierenden Teilen: einem Andante cantabile, gefolgt von einem fieberhaften und virtuosen Presto brillante. Bei seiner Uraufführung wurde es vom Publikum begeistert aufgenommen.
Bénédicte Gandois
Übersetzt aus dem Englischen mit www.DeepL.com/Translator
- Der Autor dankt Sona Igityan für ihre Kommentare zu den Arbeiten an dieser Aufnahme.
- Genrikh Litinsky ist beispielsweise Autor von Sowjetische polyphone Kunst (1954) und Polyphone Übungen für Komponisten (1965), und sein Artikel Einige Merkmale der sowjetischen Kompositionsschule begründete 1986 die moderne sowjetische Kontrapunktschule. Quelle: Nune Melikyan, Arno Babadjanian: an Armenian Composer in the Soviet Context, S. 23.
- Quelle: Svetlana Sarskisyan, Dedicated to Arno Babadjanian, Eriwan, Antares, 2008, S. 24, zitiert von Nune Melikyan, op. cit.
- Svetlana Sarskisyan, Artikel von 2011, S. 32, zitiert von Nune Melikyan, op. cit..
- Nune Melikyan, op. cit., S. 57.
- Nune Melikyan, op. cit., S. 58.
SONA IGITYAN
Sona Igityan wurde in eine Künstlerfamilie geboren und begann im Alter von sieben Jahren an einer der besten Musikschulen ihrer Heimatstadt Eriwan mit dem Klavierunterricht. Sie hatte das Glück, bei der außergewöhnlichen Lehrerin Venus Haroutunian zu lernen. Dank ihrer ersten Lehrerin erlangte Sona einen besonders tiefen und weichen Klang sowie eine geschmeidige Klaviertechnik. Drei Jahre später gab sie mit dem Nationalen Kammerorchester Armeniens eine bemerkenswerte Aufführung von Bachs Klavierkonzert in g-Moll.
Im Alter von zwölf Jahren wurde Sona für eine Sendung im nationalen Rundfunk ausgewählt und gewann mit siebzehn Jahren den Preis für die beste Darbietung beim New Names Festival in Eriwan. Sona wurde von renommierten Lehrern wie Willy Sarkissian in Armenien, Elisabeth Athanassova, Michel Kiener, Jean-Jacques Balet und Paul Coker in der Schweiz sowie Paco Moya in Spanien unterrichtet. Sie erhielt 1996 ihr Solisten- und Kammermusikdiplom am Komitas-Staatskonservatorium in Eriwan und 2007 an der Haute École de Musique de Genève. Im Alter von 14 Jahren begann sie ihre Konzertkarriere und ist seitdem als Solistin und Kammermusikerin in verschiedenen Städten in Armenien, Deutschland, Frankreich, den Niederlanden, Spanien und der Schweiz tätig.
In der Schweiz spielt sie regelmäßig bei Musikveranstaltungen wie Musique en été in der Genfer Altstadt, dem Klavierfestival Concertus Saisonnus, dem Festival du Jura, der Fête de la Musique de Genève, den 20heures de Musique in Romont, der Galerie La Primaire in Genf und dem PianoFest Moudon im Waadtland. Das Repertoire von Sona Igityan umfasst verschiedene Epochen und Stilrichtungen, von Barock bis zur zeitgenössischen Musik. Mit einer ausgeprägten Vorliebe für moderne Musik sorgt sie oft für die Aufführung von Werken zeitgenössischer Komponisten wie Ashot Zohrabian, Edouard Sadoyan, Karl Haydmayer und Shauna Beesly. Obwohl Sona sich für verschiedene Formen des künstlerischen Ausdrucks wie Theater, Kino und Literatur interessiert, ist die Musik für sie vor allem eine Art Religion und vermittelt die absolute Wahrheit.
Return to the album | Read the booklet | Open online links | Composer(s): Arno Babadjanian | Main Artist: Sona Igityan