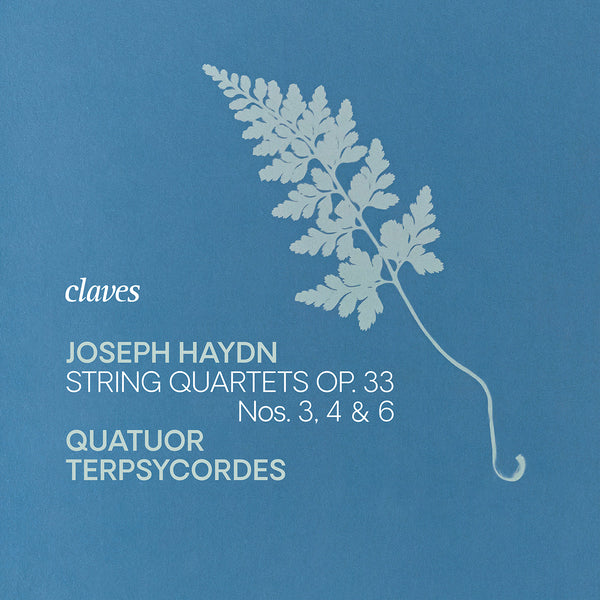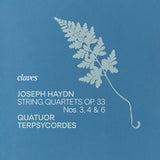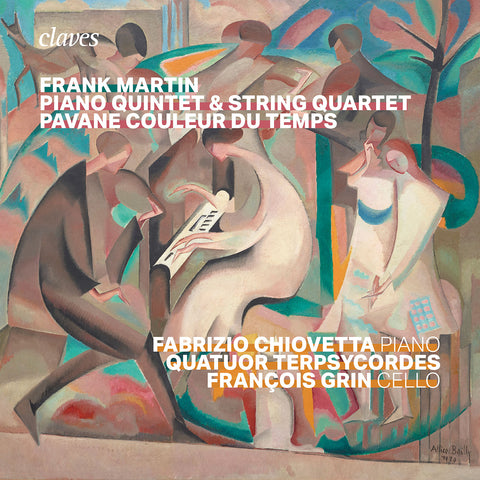(2025) Haydn: String Quartets, Op. 33, Nos. 3,4,6
Kategorie(n): Kammermusik
Instrument(e): Violoncello Viola Geige
Hauptkomponist: Joseph Haydn
Ensemble: Quatuor Terpsycordes
CD-Set: 1
Katalog Nr.:
CD 3112
Freigabe: 07.11.2025
EAN/UPC: 7619931311227
Dieses Album ist jetzt neu aufgelegt worden. Bestellen Sie es jetzt zum Sonderpreis vor.
CHF 18.50
Dieses Album ist nicht mehr auf CD erhältlich.
Dieses Album ist noch nicht veröffentlicht worden. Bestellen Sie es jetzt vor.
CHF 18.50
Dieses Album ist nicht mehr auf CD erhältlich.
CHF 18.50
Inklusive MwSt. für die Schweiz und die EU
Kostenloser Versand
Dieses Album ist nicht mehr auf CD erhältlich.
Inklusive MwSt. für die Schweiz und die EU
Kostenloser Versand
Dieses Album ist jetzt neu aufgelegt worden. Bestellen Sie es jetzt zum Sonderpreis vor.
CHF 18.50
Dieses Album ist nicht mehr auf CD erhältlich.
This album has not been released yet.
Pre-order it at a special price now.
CHF 18.50
Dieses Album ist nicht mehr auf CD erhältlich.
CHF 18.50
Dieses Album ist nicht mehr auf CD erhältlich.
SPOTIFY
(Verbinden Sie sich mit Ihrem Konto und aktualisieren die Seite, um das komplette Album zu hören)
HAYDN: STRING QUARTETS, OP. 33, NOS. 3,4,6
JOSEPH HAYDN, STREICHQUARTETTE OP. 33 NR. 3, 4 UND 6
Joseph Haydn sagte oft, er habe ein „vorbildliches Schicksal” gehabt: Aus dem Nichts heraus wurde er zu einem der berühmtesten Komponisten seiner Zeit. Er wurde in Rohrau, etwa fünfzig Kilometer östlich von Wien, in eine relativ bescheidene Familie geboren – sein Vater war Radmacher, ein anerkannter und angesehener Handwerksmeister. Das musikalische Talent des Kindes wurde schnell erkannt; er wurde zunächst nach Hainburg und später nach Wien geschickt, wo er bis zu seinem sechzehnten Lebensjahr als Chorsänger am Stephansdom tätig war. Seine entschiedene Weigerung, eine kirchliche Laufbahn einzuschlagen, führte dazu, dass er auf die Straße ging; dort begegnete er dem berühmten Chorleiter Porpora, der ihn als Begleiter für seinen Gesangsunterricht engagierte und ihn in einer Dachkammer unterbrachte, in der im Winter manchmal Schnee auf sein Bett fiel, wo er jedoch Italienisch, Gesang und Komposition lernen konnte. Seine Karriere begann jedoch mit Streichquartetten: 1757 komponierte der junge Haydn seine ersten Quartette (Op. 1 und 2) für Baron Fürnberg. Diese Stücke, die ein neues Genre darstellten und sich von den üblichen Divertimenti unterschieden, erzielten schnell einen immensen Erfolg, und Kopien waren in ganz Europa zu finden. Kurz darauf wurde der Komponist zum Kapellmeister ernannt, und ein Jahr später, nach seiner unglücklichen Ehe mit Maria-Anna Keller, trat er in den Dienst von Fürst Paul Anton Esterházy, einer der reichsten Familien Ungarns. Haydn, der Prinz Nikolaus sehr verbunden war, behielt seine Position dreißig Jahre lang und komponierte für die beiden Theater auf dem Esterháza-Anwesen fast alle seine Opern und die meisten seiner symphonischen und kammermusikalischen Werke, bevor er London während zweier Aufenthalte entdeckte, bei denen er triumphierend gefeiert wurde. Nach seiner Rückkehr nach Wien im Jahr 1795 komponierte er neben vielen anderen Werken seine berühmtesten Oratorien und Messen, bis zu seinem Tod am 31. Mai 1809, zwei Wochen nach der Kapitulation Wiens vor den Truppen Napoleons.
Joseph Haydn war einer der bedeutendsten Musiker seiner Zeit, sowohl aufgrund der schieren Anzahl seiner Werke als auch aufgrund seiner bedeutenden Beiträge zu verschiedenen Genres. Neben Boccherini war er der Begründer des Streichquartetts, einem neuen Genre, das vier Instrumente derselben Familie gleichberechtigt nebeneinander stellte und ihnen einen Dialog ohne die Notwendigkeit eines Continuo-Basses ermöglichte. Lange Zeit wurden dem Komponisten dreiundachtzig Streichquartette zugeschrieben, basierend auf der vollständigen Ausgabe seines Schülers Ignaz Pleyel aus dem Jahr 1801. Heute beläuft sich ihre Zahl auf achtundsechzig, die den Zeitraum von 1757 bis 1803, von der Geburt des Genres bis zum Beginn der Romantik, umfassen.
Die sechs Quartette op. 33 nehmen eine zentrale Stellung innerhalb dieses reichen Schaffens ein. Sie entstanden zwischen Juni und November 1781 und „gehören zu einem völlig neuen und besonderen Genre, denn ich habe seit zehn Jahren keine mehr geschrieben”, erklärte der Komponist. Haydn, der zu dieser Zeit in ganz Europa bekannt war, hatte bereits etwa dreißig Quartette geschrieben und sollte noch über dreißig weitere komponieren. Was war nun dieses „neue und besondere“ Genre? Erstens eine Veränderung des Tons: Das Quartett blieb zwar ein „gelehrtes“ Werk, integrierte jedoch eine wahrhaft populäre Dimension, wie die Finales in Rondoform belegen. Zweitens sind die Stücke prägnanter und der Ton leichter, wobei der charakteristische Humor des Komponisten zum Vorschein kommt, während „meistens eine große innere Komplexität verborgen bleibt“ (Orin Moe), da der Komponist Freude daran hatte, jedes kleine thematische Element weiterzuentwickeln. Diese Quartette hatten einen entscheidenden Einfluss auf den jungen Mozart und inspirierten viele Nachfolger wie Franz Hoffmeister und Ignaz Pleyel, die dazu beitrugen, die Form des Streichquartetts zu verewigen.
Das dritte Quartett op. 33 (Hob. III.39), das den Beinamen „Der Vogel“ trägt, beginnt mit einem absteigenden Thema über zwei Oktaven in der ersten Violine, das vielleicht an das Trillern eines Vogels erinnert, wobei ein kleines Sechzehntelmotiv in der Melodie sofort von der Bratsche und dem Cello als Begleitfigur aufgegriffen wird. Diese Mehrdeutigkeit zwischen Melodie und Begleitung ist eines der Merkmale von Haydns Stil, der „auf Einheit in der Vielfalt abzielt”. Diese manchmal humorvollen Eigenschaften richten sich in erster Linie „an Kenner, die ihre Raffinesse und ihren Witz zu schätzen wissen“ (Frédéric Gonin). Der zweite Satz, „Scherzando“, beginnt mit den vier Stimmen in Homophonie in C-Dur, in einer leisen Dynamik, die im Kontrast zum leichten Dialog zwischen den beiden Violinen steht, den einzigen Protagonisten des Trios. Das Adagio in F-Dur ist zart und ausdrucksstark, dann dramatisch in seinem Mittelteil; es ist „Haydns letzter Quartettsatz, der die Carl Philipp Emanuel Bach so wichtige abwechslungsreiche Reprise verwendet“, während das finale Presto mit seinem sehr populären Charakter „das erste“ der Quartette des Komponisten ist, „das ausdrücklich die Bezeichnung Rondo trägt“ (M. Vignal). Es ist daher verständlich, warum Op. 33 als echter stilistischer Wendepunkt gilt.
Das vierte Quartett, Op. 33 (Hob.III.40), in B-Dur, beginnt mit einem Allegro moderato, dessen Thema für Haydns Humor charakteristisch ist. Der Komponist liebte es, mit Melodien zu überraschen, die nicht dem üblichen Muster von „Impuls, Höhepunkt, Schluss“ folgen: Das Thema in der ersten Violine beginnt mit einem wiederholten Kadenzmotiv, das durch Triller unterstrichen wird. Einige Takte später wiederholt der Komponist die Zelle F-F-D dreimal, bevor sie im Cello wieder auftaucht, als hätte dieses nicht rechtzeitig aufhören können! Mozart griff diesen Scherz im Finale seines Haydn gewidmeten Quartetts KV 458 auf, das in derselben Tonart geschrieben ist. Weitere Überraschungen erwarten den Zuhörer in diesem Allegro in Sonatenform. Das folgende Scherzo im Dreiertakt erinnert an ein Menuett und umrahmt ein Trio in Moll, bevor das schöne Largo in Es folgt, das in drei Teilen um drei Wiederholungen des Hauptthemas herum aufgebaut ist: Zunächst wird es vorgestellt, dann in einem stark modulierenden Diskurs weiterentwickelt, erscheint erneut in einem leuchtenden Dur und wird vor seinem dritten Auftritt und der Coda weiterentwickelt. Das Finale ist ein weiteres Beispiel für Haydns charakteristischen Humor. Aufgebaut als Rondo in einer A-B-A'-C''-Struktur, durchläuft es Modulationen, die manchmal den Eindruck einer falschen Note erwecken, und endet mit einer Coda, in der das Thema mit Pausen durchsetzt ist, sich dann in langen Notenwerten ausdehnt, bevor es in Pizzicatos endet, wie ein Scherz, und einmal mehr beweist, dass der Humor Haydns – eines Komponisten, der seinen Zeitgenossen zufolge sowohl ernst als auch fröhlich war – „aus einer ästhetischen und analytischen Reflexion stammt, die so tiefgründig und erhaben ist, dass [...] wir sie auch heute noch mit Freude schätzen” (F. Gonin).
Das sechste Quartett, Op. 33 (Hob.III.42), steht schließlich in D-Dur. Subtil konstruiert und mit kleinen Motiven spielend, präsentiert der erste Satz ein acht Takte langes Thema, dessen letzte vier Takte eine Variation der ersten vier sind. Es überrascht den Zuhörer mit einer falschen Reprise, die der eigentlichen Reprise vorausgeht, die nur den variierten Teil des Themas enthält. Es folgt das beruhigende und meditative Andante in d-Moll, dessen Thema von der zweiten Violine über einer langen, von der ersten Violine gespielten Note präsentiert wird, bevor ein echter Dialog zwischen den vier Instrumenten entsteht. Das Scherzo mit seinen deutlich markierten Taktschlägen und Akzenten räumt dem Cello im Trio einen Ehrenplatz ein, bevor das Scherzo wiederkehrt. Das ruhige Finale ist eine Reihe von Variationen (A-B-A'-B'-A'‚-B‘'), die zwischen einem Dur- und einem Moll-Teil wechseln und als kleiner Scherz ein falsches Ende vor dem eigentlichen Schluss enthalten.
Joseph Haydn pflegte bei der Aufführung seiner Quartette die erste Violine zu spielen, wie Giovanni Paisiello, ein italienischer Komponist, der für eine seiner Opern nach Wien gekommen war, 1784 in seinen Memoiren berichtete. Die Bratsche wurde damals von Wolfgang Amadeus Mozart gespielt, der über seinen 24 Jahre älteren Mentor sagte: „Er allein hat das Geheimnis, mich zum Lächeln zu bringen, mich bis in die Tiefen meiner Seele zu berühren ...” Diese Quartette, in denen Komplexität mit Humor und Wissenschaftliches mit Populärem verbunden sind, werden ihre Zuhörer zweifellos berühren.
Bénédicte Gandois
Übersetzt aus dem Englischen mit www.DeepL.com/Translator
Bibliografie
VIGNAL, Marc, „Haydn“, in: François-René Tranchefort, Guide de la musique de chambre, Fayard, Paris, 1989.
GONIN, Frédéric, Quatre regards sur les quatuors de Joseph Haydn, Delatour-France, Sampzon, 2012.
BARBAUD, Pierre, Haydn, Seuil, coll. Solfèges, 1963.
ROBBINS Landon, H. C., Haydn, Chêne/ Hachette, Paris, 1981.
QUATUOR TERPSYCORDES
Das Terpsycordes Quartett definiert die Verbindung zwischen einem Musikensemble und seinem Publikum neu. Es erfindet neue Wege, ein Kammermusikkonzert zu erleben, und engagiert sich dafür, benachteiligte sowie junge Zuhörer zu erreichen, um seine Kunst mit möglichst vielen Menschen zu teilen.
Das Terpsycordes Quartett ist die Geschichte einer Freundschaft, die über 25 Jahre zurückreicht. Das 1997 in Genf gegründete Quartett, das von der künstlerischen Vision von Gábor Takács-Nagy geleitet und von den Mitgliedern der Quartette Amadeus, Budapest, Hagen, Lasalle und Mosaïques unterrichtet wurde, hat sich schnell einen Namen in der Musikszene gemacht und unter anderem den ersten Preis beim Genfer Wettbewerb 2001 sowie bei anderen internationalen Wettbewerben (Weimar, Graz, Trapani) gewonnen. Begegnungen mit bedeutenden Komponisten des 20. Jahrhunderts wie György Kurtág und Sofia Gubaidulina sowie mit Persönlichkeiten aus der Welt der Barockmusik, darunter Gabriel Garrido, Chiara Banchini, Florence Malgoire und Leonardo García Alarcón, haben zur Definition und Verfeinerung der ästhetischen Entwicklung des Quartetts beigetragen. Die Mitglieder des Quartetts spielen weiterhin regelmäßig mit verschiedenen anderen Ensembles wie dem Genfer Kammerorchester, Cappella Mediterranea, Gli Angeli Genève, Contrechamps, l’Armée des Romantiques oder Elyma. Diese reichhaltige Erfahrung hat es dem Terpsycordes Quartett ermöglicht, sein Repertoire ständig zu überarbeiten. Sein Ansatz basiert auf Wahlfreiheit und Risikobereitschaft, gekennzeichnet durch das ständige Streben nach Zusammenhalt als Gruppe, ausgeglichen durch individuelle Freiheit, Respekt vor dem Text und Unabhängigkeit gegenüber der Partitur.
Das Repertoire des Terpsycordes Quartetts reicht von der vorklassischen Zeit bis zu zeitgenössischen Werken. Seit 2021 spielt es im Museum für Kunst und Geschichte in Genf einen kompletten Zyklus der Quartette von Joseph Haydn auf historischen Instrumenten und pflegt dabei eine besondere Beziehung zu den großen Genfer Komponisten des 20. Jahrhunderts – Ernest Bloch und Frank Martin. Die Veröffentlichung eines neuen Albums, das ganz den Werken von Frank Martin gewidmet ist, durch Claves Records im Frühjahr 2024 hat ihre bereits von der Kritik gefeierte Diskografie bereichert, die von Haydn bis Piazzola reicht.
Das Terpsycordes Quartett engagiert sich aktiv in sozialen und pädagogischen Projekten. Es bietet Konzerte in Zusammenarbeit mit Stiftungen, Vereinen und Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen, in prekären Situationen oder in Haft an. Außerdem arbeitet es mit Schulen in der Stadt Genf zusammen. Es bricht mit Konventionen, indem es einzigartige Erlebnisse anbietet, die darauf abzielen, seine Leidenschaft zu teilen, darunter Open-Air-Konzerte an ungewöhnlichen Orten, musikalische Radtouren oder öffentliche Proben. So schafft es originelle Gelegenheiten, um einem vielfältigen Publikum die Magie der Kammermusik näherzubringen.
Das Terpsycordes Quartett wird von der Stadt Genf und der Republik und dem Kanton Genf unterstützt.
Girolamo Bottiglieri – Geige
Raya Raytcheva – Geige
Caroline Cohen-Adad – Viola
Florestan Darbellay – Cello
Übersetzt aus dem Englischen mit www.DeepL.com/Translator
REVIEWS
"[..] La primera de ellas está dedicada a la segunda triada del magnífico Op. 33 de Haydn. Se da la extraña circunstancia de que el primer disco del Op. 33 (5, 2, 1) del Quatuor Terpsycordes se publicó en 2006. Más vale tarde que nunca: 19 años después, este cuarteto fundado en Ginebra remata la serie con los últimos 3 Cuartetos, siguiendo el orden de la edición de Artaria (5, 2, 1, 3, 6, 4). Llaman la atención el laconismo y la viveza con la que el Terpsycordes acomete el primer movimiento del n. 3 (apodado El pájaro, en esta versión queda claro por qué). Sobresalen también los primeros rondós que Haydn incorpora al género (ns. 3 y 6), adecuadamente feroces. No es imprescindible rescatar a su pareja de baile de 2006, funciona bien como disco aislado. [..]" - Daniel Pérez Navarro, Diciembre 2025
(2025) Haydn: String Quartets, Op. 33, Nos. 3,4,6 - CD 3112
JOSEPH HAYDN, STREICHQUARTETTE OP. 33 NR. 3, 4 UND 6
Joseph Haydn sagte oft, er habe ein „vorbildliches Schicksal” gehabt: Aus dem Nichts heraus wurde er zu einem der berühmtesten Komponisten seiner Zeit. Er wurde in Rohrau, etwa fünfzig Kilometer östlich von Wien, in eine relativ bescheidene Familie geboren – sein Vater war Radmacher, ein anerkannter und angesehener Handwerksmeister. Das musikalische Talent des Kindes wurde schnell erkannt; er wurde zunächst nach Hainburg und später nach Wien geschickt, wo er bis zu seinem sechzehnten Lebensjahr als Chorsänger am Stephansdom tätig war. Seine entschiedene Weigerung, eine kirchliche Laufbahn einzuschlagen, führte dazu, dass er auf die Straße ging; dort begegnete er dem berühmten Chorleiter Porpora, der ihn als Begleiter für seinen Gesangsunterricht engagierte und ihn in einer Dachkammer unterbrachte, in der im Winter manchmal Schnee auf sein Bett fiel, wo er jedoch Italienisch, Gesang und Komposition lernen konnte. Seine Karriere begann jedoch mit Streichquartetten: 1757 komponierte der junge Haydn seine ersten Quartette (Op. 1 und 2) für Baron Fürnberg. Diese Stücke, die ein neues Genre darstellten und sich von den üblichen Divertimenti unterschieden, erzielten schnell einen immensen Erfolg, und Kopien waren in ganz Europa zu finden. Kurz darauf wurde der Komponist zum Kapellmeister ernannt, und ein Jahr später, nach seiner unglücklichen Ehe mit Maria-Anna Keller, trat er in den Dienst von Fürst Paul Anton Esterházy, einer der reichsten Familien Ungarns. Haydn, der Prinz Nikolaus sehr verbunden war, behielt seine Position dreißig Jahre lang und komponierte für die beiden Theater auf dem Esterháza-Anwesen fast alle seine Opern und die meisten seiner symphonischen und kammermusikalischen Werke, bevor er London während zweier Aufenthalte entdeckte, bei denen er triumphierend gefeiert wurde. Nach seiner Rückkehr nach Wien im Jahr 1795 komponierte er neben vielen anderen Werken seine berühmtesten Oratorien und Messen, bis zu seinem Tod am 31. Mai 1809, zwei Wochen nach der Kapitulation Wiens vor den Truppen Napoleons.
Joseph Haydn war einer der bedeutendsten Musiker seiner Zeit, sowohl aufgrund der schieren Anzahl seiner Werke als auch aufgrund seiner bedeutenden Beiträge zu verschiedenen Genres. Neben Boccherini war er der Begründer des Streichquartetts, einem neuen Genre, das vier Instrumente derselben Familie gleichberechtigt nebeneinander stellte und ihnen einen Dialog ohne die Notwendigkeit eines Continuo-Basses ermöglichte. Lange Zeit wurden dem Komponisten dreiundachtzig Streichquartette zugeschrieben, basierend auf der vollständigen Ausgabe seines Schülers Ignaz Pleyel aus dem Jahr 1801. Heute beläuft sich ihre Zahl auf achtundsechzig, die den Zeitraum von 1757 bis 1803, von der Geburt des Genres bis zum Beginn der Romantik, umfassen.
Die sechs Quartette op. 33 nehmen eine zentrale Stellung innerhalb dieses reichen Schaffens ein. Sie entstanden zwischen Juni und November 1781 und „gehören zu einem völlig neuen und besonderen Genre, denn ich habe seit zehn Jahren keine mehr geschrieben”, erklärte der Komponist. Haydn, der zu dieser Zeit in ganz Europa bekannt war, hatte bereits etwa dreißig Quartette geschrieben und sollte noch über dreißig weitere komponieren. Was war nun dieses „neue und besondere“ Genre? Erstens eine Veränderung des Tons: Das Quartett blieb zwar ein „gelehrtes“ Werk, integrierte jedoch eine wahrhaft populäre Dimension, wie die Finales in Rondoform belegen. Zweitens sind die Stücke prägnanter und der Ton leichter, wobei der charakteristische Humor des Komponisten zum Vorschein kommt, während „meistens eine große innere Komplexität verborgen bleibt“ (Orin Moe), da der Komponist Freude daran hatte, jedes kleine thematische Element weiterzuentwickeln. Diese Quartette hatten einen entscheidenden Einfluss auf den jungen Mozart und inspirierten viele Nachfolger wie Franz Hoffmeister und Ignaz Pleyel, die dazu beitrugen, die Form des Streichquartetts zu verewigen.
Das dritte Quartett op. 33 (Hob. III.39), das den Beinamen „Der Vogel“ trägt, beginnt mit einem absteigenden Thema über zwei Oktaven in der ersten Violine, das vielleicht an das Trillern eines Vogels erinnert, wobei ein kleines Sechzehntelmotiv in der Melodie sofort von der Bratsche und dem Cello als Begleitfigur aufgegriffen wird. Diese Mehrdeutigkeit zwischen Melodie und Begleitung ist eines der Merkmale von Haydns Stil, der „auf Einheit in der Vielfalt abzielt”. Diese manchmal humorvollen Eigenschaften richten sich in erster Linie „an Kenner, die ihre Raffinesse und ihren Witz zu schätzen wissen“ (Frédéric Gonin). Der zweite Satz, „Scherzando“, beginnt mit den vier Stimmen in Homophonie in C-Dur, in einer leisen Dynamik, die im Kontrast zum leichten Dialog zwischen den beiden Violinen steht, den einzigen Protagonisten des Trios. Das Adagio in F-Dur ist zart und ausdrucksstark, dann dramatisch in seinem Mittelteil; es ist „Haydns letzter Quartettsatz, der die Carl Philipp Emanuel Bach so wichtige abwechslungsreiche Reprise verwendet“, während das finale Presto mit seinem sehr populären Charakter „das erste“ der Quartette des Komponisten ist, „das ausdrücklich die Bezeichnung Rondo trägt“ (M. Vignal). Es ist daher verständlich, warum Op. 33 als echter stilistischer Wendepunkt gilt.
Das vierte Quartett, Op. 33 (Hob.III.40), in B-Dur, beginnt mit einem Allegro moderato, dessen Thema für Haydns Humor charakteristisch ist. Der Komponist liebte es, mit Melodien zu überraschen, die nicht dem üblichen Muster von „Impuls, Höhepunkt, Schluss“ folgen: Das Thema in der ersten Violine beginnt mit einem wiederholten Kadenzmotiv, das durch Triller unterstrichen wird. Einige Takte später wiederholt der Komponist die Zelle F-F-D dreimal, bevor sie im Cello wieder auftaucht, als hätte dieses nicht rechtzeitig aufhören können! Mozart griff diesen Scherz im Finale seines Haydn gewidmeten Quartetts KV 458 auf, das in derselben Tonart geschrieben ist. Weitere Überraschungen erwarten den Zuhörer in diesem Allegro in Sonatenform. Das folgende Scherzo im Dreiertakt erinnert an ein Menuett und umrahmt ein Trio in Moll, bevor das schöne Largo in Es folgt, das in drei Teilen um drei Wiederholungen des Hauptthemas herum aufgebaut ist: Zunächst wird es vorgestellt, dann in einem stark modulierenden Diskurs weiterentwickelt, erscheint erneut in einem leuchtenden Dur und wird vor seinem dritten Auftritt und der Coda weiterentwickelt. Das Finale ist ein weiteres Beispiel für Haydns charakteristischen Humor. Aufgebaut als Rondo in einer A-B-A'-C''-Struktur, durchläuft es Modulationen, die manchmal den Eindruck einer falschen Note erwecken, und endet mit einer Coda, in der das Thema mit Pausen durchsetzt ist, sich dann in langen Notenwerten ausdehnt, bevor es in Pizzicatos endet, wie ein Scherz, und einmal mehr beweist, dass der Humor Haydns – eines Komponisten, der seinen Zeitgenossen zufolge sowohl ernst als auch fröhlich war – „aus einer ästhetischen und analytischen Reflexion stammt, die so tiefgründig und erhaben ist, dass [...] wir sie auch heute noch mit Freude schätzen” (F. Gonin).
Das sechste Quartett, Op. 33 (Hob.III.42), steht schließlich in D-Dur. Subtil konstruiert und mit kleinen Motiven spielend, präsentiert der erste Satz ein acht Takte langes Thema, dessen letzte vier Takte eine Variation der ersten vier sind. Es überrascht den Zuhörer mit einer falschen Reprise, die der eigentlichen Reprise vorausgeht, die nur den variierten Teil des Themas enthält. Es folgt das beruhigende und meditative Andante in d-Moll, dessen Thema von der zweiten Violine über einer langen, von der ersten Violine gespielten Note präsentiert wird, bevor ein echter Dialog zwischen den vier Instrumenten entsteht. Das Scherzo mit seinen deutlich markierten Taktschlägen und Akzenten räumt dem Cello im Trio einen Ehrenplatz ein, bevor das Scherzo wiederkehrt. Das ruhige Finale ist eine Reihe von Variationen (A-B-A'-B'-A'‚-B‘'), die zwischen einem Dur- und einem Moll-Teil wechseln und als kleiner Scherz ein falsches Ende vor dem eigentlichen Schluss enthalten.
Joseph Haydn pflegte bei der Aufführung seiner Quartette die erste Violine zu spielen, wie Giovanni Paisiello, ein italienischer Komponist, der für eine seiner Opern nach Wien gekommen war, 1784 in seinen Memoiren berichtete. Die Bratsche wurde damals von Wolfgang Amadeus Mozart gespielt, der über seinen 24 Jahre älteren Mentor sagte: „Er allein hat das Geheimnis, mich zum Lächeln zu bringen, mich bis in die Tiefen meiner Seele zu berühren ...” Diese Quartette, in denen Komplexität mit Humor und Wissenschaftliches mit Populärem verbunden sind, werden ihre Zuhörer zweifellos berühren.
Bénédicte Gandois
Übersetzt aus dem Englischen mit www.DeepL.com/Translator
Bibliografie
VIGNAL, Marc, „Haydn“, in: François-René Tranchefort, Guide de la musique de chambre, Fayard, Paris, 1989.
GONIN, Frédéric, Quatre regards sur les quatuors de Joseph Haydn, Delatour-France, Sampzon, 2012.
BARBAUD, Pierre, Haydn, Seuil, coll. Solfèges, 1963.
ROBBINS Landon, H. C., Haydn, Chêne/ Hachette, Paris, 1981.
QUATUOR TERPSYCORDES
Das Terpsycordes Quartett definiert die Verbindung zwischen einem Musikensemble und seinem Publikum neu. Es erfindet neue Wege, ein Kammermusikkonzert zu erleben, und engagiert sich dafür, benachteiligte sowie junge Zuhörer zu erreichen, um seine Kunst mit möglichst vielen Menschen zu teilen.
Das Terpsycordes Quartett ist die Geschichte einer Freundschaft, die über 25 Jahre zurückreicht. Das 1997 in Genf gegründete Quartett, das von der künstlerischen Vision von Gábor Takács-Nagy geleitet und von den Mitgliedern der Quartette Amadeus, Budapest, Hagen, Lasalle und Mosaïques unterrichtet wurde, hat sich schnell einen Namen in der Musikszene gemacht und unter anderem den ersten Preis beim Genfer Wettbewerb 2001 sowie bei anderen internationalen Wettbewerben (Weimar, Graz, Trapani) gewonnen. Begegnungen mit bedeutenden Komponisten des 20. Jahrhunderts wie György Kurtág und Sofia Gubaidulina sowie mit Persönlichkeiten aus der Welt der Barockmusik, darunter Gabriel Garrido, Chiara Banchini, Florence Malgoire und Leonardo García Alarcón, haben zur Definition und Verfeinerung der ästhetischen Entwicklung des Quartetts beigetragen. Die Mitglieder des Quartetts spielen weiterhin regelmäßig mit verschiedenen anderen Ensembles wie dem Genfer Kammerorchester, Cappella Mediterranea, Gli Angeli Genève, Contrechamps, l’Armée des Romantiques oder Elyma. Diese reichhaltige Erfahrung hat es dem Terpsycordes Quartett ermöglicht, sein Repertoire ständig zu überarbeiten. Sein Ansatz basiert auf Wahlfreiheit und Risikobereitschaft, gekennzeichnet durch das ständige Streben nach Zusammenhalt als Gruppe, ausgeglichen durch individuelle Freiheit, Respekt vor dem Text und Unabhängigkeit gegenüber der Partitur.
Das Repertoire des Terpsycordes Quartetts reicht von der vorklassischen Zeit bis zu zeitgenössischen Werken. Seit 2021 spielt es im Museum für Kunst und Geschichte in Genf einen kompletten Zyklus der Quartette von Joseph Haydn auf historischen Instrumenten und pflegt dabei eine besondere Beziehung zu den großen Genfer Komponisten des 20. Jahrhunderts – Ernest Bloch und Frank Martin. Die Veröffentlichung eines neuen Albums, das ganz den Werken von Frank Martin gewidmet ist, durch Claves Records im Frühjahr 2024 hat ihre bereits von der Kritik gefeierte Diskografie bereichert, die von Haydn bis Piazzola reicht.
Das Terpsycordes Quartett engagiert sich aktiv in sozialen und pädagogischen Projekten. Es bietet Konzerte in Zusammenarbeit mit Stiftungen, Vereinen und Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen, in prekären Situationen oder in Haft an. Außerdem arbeitet es mit Schulen in der Stadt Genf zusammen. Es bricht mit Konventionen, indem es einzigartige Erlebnisse anbietet, die darauf abzielen, seine Leidenschaft zu teilen, darunter Open-Air-Konzerte an ungewöhnlichen Orten, musikalische Radtouren oder öffentliche Proben. So schafft es originelle Gelegenheiten, um einem vielfältigen Publikum die Magie der Kammermusik näherzubringen.
Das Terpsycordes Quartett wird von der Stadt Genf und der Republik und dem Kanton Genf unterstützt.
Girolamo Bottiglieri – Geige
Raya Raytcheva – Geige
Caroline Cohen-Adad – Viola
Florestan Darbellay – Cello
Übersetzt aus dem Englischen mit www.DeepL.com/Translator
REVIEWS
"[..] La primera de ellas está dedicada a la segunda triada del magnífico Op. 33 de Haydn. Se da la extraña circunstancia de que el primer disco del Op. 33 (5, 2, 1) del Quatuor Terpsycordes se publicó en 2006. Más vale tarde que nunca: 19 años después, este cuarteto fundado en Ginebra remata la serie con los últimos 3 Cuartetos, siguiendo el orden de la edición de Artaria (5, 2, 1, 3, 6, 4). Llaman la atención el laconismo y la viveza con la que el Terpsycordes acomete el primer movimiento del n. 3 (apodado El pájaro, en esta versión queda claro por qué). Sobresalen también los primeros rondós que Haydn incorpora al género (ns. 3 y 6), adecuadamente feroces. No es imprescindible rescatar a su pareja de baile de 2006, funciona bien como disco aislado. [..]" - Daniel Pérez Navarro, Diciembre 2025
Return to the album | Read the booklet | Open online links | Composer(s): Joseph Haydn | Main Artist: Quatuor Terpsycordes